Die Creator Economy hat weite Teile der Medienindustrie erobert. Wie sie sich in Deutschland entwickelt hat, beschreibe ich in der dritten Auflage des Sammelbands “Influencer Marketing”. Das von Marlis Jahnke herausgegebene Buch erscheint bei Springer Gabler und kann sowohl als Hardcover als auch als E-Book bezogen werden. In diesem Blogpost bekommt ihr eine Leseprobe meines Beitrags mit der Überschrift “Von Kinderzimmerstars zu Medienunternehmern – Der Aufstieg der Creator Economy”.
Zum dritten Mal bin ich Teil der Autorenriege des Buchs “Influencer Marketing”. Die Idee zu dem Buch entstand im September 2017 beim Influencer Camp in Hamburg. Johannes Lenz und Sachar Klein hatten die Veranstaltung organisiert. Dort lernte ich Marlis Jahnke kennen, die mit ihrer mittlerweile verkauften Agentur InPromo eine Influencer-Plattform aufgebaut hatte. Sie berichtete von ihrer Idee eines Sach- und Lehrbuchs für Influencer Marketing. Ich fand die Idee super und bot an, einen Beitrag über das Thema “Netzwerke” zu schreiben, in dem ich die Entwicklung der YouTube-Netzwerke in Deutschland erklärte. Die These des Original-Beitrags ist bis heute geblieben: Nur, wer sich vernetzt, hat eine Chance auf eine langfristige Creator-Karriere.

Hier, an der Hochschule in Hamburg, entstand 2017 die Idee für das Influencer-Marketing-Buch. Foto: Johannes Lenz
Die zweite Auflage erschien vier Jahre später, mitten in der Corona-Pandemie. Seitdem hatte sich viel getan. Die YouTube-Netzwerke waren endgültig Geschichte. Dafür war mit TikTok eine neue und hochspannende Plattform aufgekommen. Dennoch konnte ich wesentliche Teile meines Textes übernehmen. Es war eine leicht aktualisierte Version.
Nun sind nochmal vier Jahre vergangen. Ende 2024 rief mich Marlis an und kündigte an, dass es eine dritte Ausgabe geben werde und fragte, ob ich erneut dabei sein wolle. Natürlich wollte ich. Diesmal war klar: Acht Jahre nach der ersten Auflage muss mehr oder weniger ein neues Kapitel her. Ich nutzte die Zeit zwischen den Jahren für eine große Überarbeitung und Aktualisierung des ersten Textes, von dem lediglich ein paar Bausteine übrig geblieben sind. In einem, wie ich hoffe, anschaulichen Beitrag lest ihr nun, wie sich “YouTuber:innen” zu “Influencer:innen” entwickelten und nun in der Ära “Creator Economy” zum festen Bestandteil der Medienbranche geworden sind.
Weitere Beiträge kommen von Sandra Gärtner, Ann-Kathrin Harms, Fabian Held, André Krüger, Stefanie Lefeldt, Jeanette Okwu, Christina Richter, Adil Sbai, Monika Sekara, Tim Hendrik Walter (@HerrAnwalt), Susanne Wilpers. Wer die Hintergründe der Creator Economy verstehen möchte, sollte sich diese massiv überarbeitete und sehr aktuelle Ausgabe des Influencer-Marketing-Buchs von Marlis ins Regal stellen.
Und nun die Leseprobe
Um zu verstehen, wie die Creator Economy funktioniert, muss man zurück zu den Anfängen einer Branche gehen, die ihrerseits bereits seit gut 20 Jahren existiert und damit längst „erwachsen“ geworden ist. Am Ende ihrer Entwicklung ist sie freilich noch lange nicht. Von vielen Experten und Expertinnen wird sie als Teil der Entertainment-Branche mit dem größten Wachstumspotenzial gesehen. So schätzt der Ökonom Doug Shapiro in seinem Blog, dass die Creator Economy bis 2030 von derzeit 250 Mrd. auf 600 Mrd. Dollar wachsen wird. Das entspräche einem Viertel des Gesamtvolumens der Medienindustrie (Shapiro, 2024). Doch wie hat diese Entwicklung begonnen?
Von User Generated Content zu Video-Netzwerken
Als im Jahr 2005 Jawed Karim, Steve Chen und Chad Hurley ihre Seite youtube.com ins Netz stellten, hatten die Gründer zunächst mal eine Plattform im Sinn, die es jedem Nutzer ermöglichen sollte, möglichst einfach eigene Videos im Internet zu verbreiten. An eine Content- oder gar Monetarisierungsstrategie hatten die Gründer damals noch nicht gedacht. Folgerichtig waren die Inhalte auf YouTube in den Anfangsjahren sehr stark vom Zufall bestimmt. Es war das Prinzip des „User Generated Content“, aus dessen Masse immer wieder virale Hits herausragten wie die Spitze eines gigantischen Eisbergs aus dem Wasser.
Dieses Prinzip gilt bis heute. Zwar liefern Creator und Medienorganisationen inzwischen die reichweitenstärksten Clips und dominieren die Trends der Plattform. Für die große Masse an Inhalten sind einfache Nutzer verantwortlich, deren Inhalte viel kleinere Reichweiten haben und kaum Interaktion hervorrufen. YouTube selbst gibt dazu keine Zahlen heraus. Das Projekt tubestats.org der University of Massachusetts Amherst nutzt darum eine aufwändig erstellte Zufallsstichprobe von mehr als 10.000 Video-IDs, um mehr über die Struktur von YouTube zu lernen (McGrady et al 2023). Mehr als 14,8 Mrd. Videos sind den Hochrechnungen nach derzeit auf YouTube zu finden. Den Forschern zufolge haben 87 % der auf YouTube hochgeladenen Videos weniger als 1000 Views und nur auf sieben Prozent der Videos findet Werbung statt.
Was heute TikTok ist, war in den Anfängen des Onlinevideo-Zeitalters YouTube. Die Plattform entpuppte sich schnell als Viralmaschine, auf der einfache Leute in kurzer Zeit einem Millionenpublikum bekannt wurden. Die Urheber dieser Clips veröffentlichten ihre Inhalte mehr oder weniger ohne redaktionelles Konzept und wurden zumeist von ihrer plötzlichen Popularität überrascht. Paradebeispiel wäre das Video „Charlie bit my finger“, das bis heute mehrere Hundert Millionen Mal auf YouTube angesehen wurde. Es zeigt einen kleinen Jungen, der seinem großen Bruder in den Finger beißt. Hochgeladen hat es der Vater der beiden Jungs, der den Clip lediglich seinen Verwandten zeigen wollte.
Andere, bekannte Videos dieser Kategorie sind das „Zombie Kid“ („I like turtles“) oder die eigenwillige Webcam-Version des Songs „Dragosta din tei“ von Gary Brolsma („Numa Numa“). Schaut man sich diese Videos heute an, braucht es nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was diese Videos möglicherweise ausgelöst hätten, wenn ihre Erschaffer schon damals ein Smartphone und eine Plattform namens TikTok zur Verfügung gehabt hätten. Sie waren die Prototypen der Meme- und Community-Culture, die heute der wesentliche Treiber von Social-Media-Reichweite sind. Nur, dass damals keine Marke jemals auf die Idee gekommen wäre, mit diesen Menschen eine Werbekampagne zu starten. Auch das hat sich geändert. Aber bis sich dieser Kreis schließen konnte, sollte es noch ein paar Jahre dauern.
Ende der Nuller-Jahre begannen immer mehr und vor allem junge Menschen, YouTube zu nutzen, um sich und ihren Alltag im Netz zu zeigen. Für die junge Generation war YouTube ein Dialogmedium, um sich mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten über Dinge auszutauschen, die sie in ihrem Alltag beschäftigten. Das manifestierte sich insbesondere in einem Feature, dem Youtuber der ersten Stunde bis heute nostalgisch nachtrauern. YouTube ermöglichte bis 2013 Videoantworten. So konnte man mit einem eigenen Video direkt auf ein bereits hochgeladenes Reagieren. In gewisser Weise war dies ein Vorbote der Reaction-Kultur, die heute ebenfalls fester Bestandteil der Social-Media-Welt ist. Auf TikTok können User mit Duetten die Inhalte anderer Creator für ihre Videos nutzen und erweitern. Auf Twitch und YouTube gibt es ganze Livestreams, in denen Creator sich live bereits vorhandene Videos auf anderen Plattformen angucken und darauf reagieren. Nicht selten führt dies zu einer schier endlosen Kette von Reaktionen auf Reaktionen auf Reaktionen.
Eine ganze Generation hat sich auf YouTube, weitgehend unbehelligt von etablierten Anbietern aus der alten Medienwelt, ihr eigenes Programm erschaffen. Damit hat sie die Art und Weise revolutioniert, wie wir Bewegtbild erstellen, verbreiten und konsumieren. Inhaltlich legten die ersten Creator bereits die Grundlage für viele Genres, die fortan das Programm auf den Online-Plattformen und die damit verbundene Vermarktung prägen sollten. Dabei handelte es sich vielfach um Themen, die junge Menschen in ihrem Alltag bewegen, die in klassischen Medien allerdings nur sehr reduziert bis gar nicht stattfanden. Zudem verbreiteten die Sender und Verlage diese Themen in einer Form, die den Unterhaltungs- und Informationsbedürfnissen junger Menschen überhaupt nicht entgegenkam. Der mit Onlineforen und Messenger-Diensten aufgewachsenen Onlinegeneration war es wichtiger, Teil einer Gemeinschaft und auf Augenhöhe mit den Videomachern zu sein. Sie identifizierten sich mit den Creatorn, interagierten mit ihnen und gestalteten auf diese Weise ihr eigenes Programm mit.
Zu den schon damals populären Themen gehörten Gaming-Videos, Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Formate, praxisnahe Tutorials, mit denen sich etwas lernen ließ, lustige Musikparodien und Sketche und vor allem schlicht und einfach alltägliche Vlogs; Videotagebücher, in denen Creator anderen Menschen Einblicke in ihr Leben gaben. Let’s-Play-Urgestein Gronkh berichtet in der Anfang 2025 erschienenen Doku „Alles auf Anfang“ recht anschaulich, wie diese Szene entstand: „Ich habe einfach Anekdoten erzählt und Scheiße gelabert. Und dann ist daraus mein Beruf geworden.“ (Gronkh, 2025)
Da es auf YouTube keine Programmaufsicht oder andere Gatekeeper gab, passierte dort schlicht und einfach das, was die Creator getrieben vom Feedback ihrer Fans tagtäglich veröffentlichten.
Die ersten Kollabos
Bereits in dieser frühen Phase der Onlinevideo-Bewegung entstanden die ersten, losen Kollaborationen von Künstlern. Die Gründe dafür lagen auf der Hand: Erstens machte es mehr Spaß, Videos gemeinsam zu produzieren. Zweitens verbesserte sich die Produktionsqualität merklich, wenn man sich gegenseitig mit Ausrüstung und Fachwissen unterstützen konnte. Drittens wirkte sich eine Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler meist positiv auf die eigene Reichweite aus, da man gegenseitig die Zuschauer aufeinander aufmerksam machen konnte. Es dauerte nicht lange und aus freundschaftlichen Verbindungen wurden Geschäftsbeziehungen.
In Deutschland hatte sich z. B. eine Gruppe von Beauty- und Lifestyle-Vloggerinnen zusammengetan: Die YouTuberinnen „xKarenina“, „Vorstadtcinderella“, „Lynniiieee“ und „Koko von Kosmo“ bildeten schon 2009 als „Frag die Gurus“ eine Art Prototyp der späteren Netzwerke. „Frag die Gurus“ organisierte nicht nur gegenseitige Cross-Promotion, sondern unternahm auch erste Versuche, die eigenen Inhalte gemeinsam zu vermarkten, z. B. mit einer eigenen Kosmetiklinie (Kusak, 2011). Zur damaligen Zeit, als die meisten YouTuber buchstäblich noch in den Kinderschuhen steckten, waren das geradezu revolutionäre Ideen, in denen bereits der Keim für die spätere Creator Economy steckte.
Parallel dazu hatte sich auch auf YouTube einiges getan. Die Videoplattform war im Jahr 2006 von Google gekauft worden. Der Internetgigant versuchte nun, ein tragfähiges Geschäftsmodell für YouTube zu entwickeln. Im Mittelpunkt dieser Überlegungen standen die neuen Videomacher, deren Reichweite Google nun an Werbekunden vermarkten wollte. An den erzielten Einnahmen sollten die Künstler beteiligt werden. Das sogenannte „Partnerprogramm“, gestartet im Jahr 2008, war der entscheidende Schritt zur Professionalisierung, aber auch zur Kommerzialisierung von YouTube. Auf einmal war es möglich, mit Videos auf YouTube Geld zu verdienen. Dazu benötigte YouTube aber Inhalte, die auch auf Fernsehstandard produziert waren. Die Creator sollten ihre Inhalte von nun an regelmäßig, zuverlässig und professionell verbreiten. Und dabei brauchten sie Unterstützung. Aus dieser Situation heraus entstanden die so genannten Multi-Channel-Networks.
Das Geschäft beginnt – Die Entstehung der MCNs
Im Sommer 2011 trafen sich ein gutes Dutzend der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands in Hamburg, um sich zum ersten deutschen Online-Video-Netzwerk „Mediakraft“ zusammenzuschließen. Zu den ersten „Netzwerkern“ gehörten die Comedy-Truppe Y-Titty, Vlogger iBlali, Musik- und Tech-YouTuber AlexiBexi oder die Schauspielerin Nilam Farooq, die damals als „Daaruum“ eine der erfolgreichsten Beauty- und Lifestyle-Vloggerinnen war.
Die Geschäftsleitung des neuen Unternehmens übernahmen der erfahrene YouTube- und TV-Produzent Christoph Krachten, der international vernetzte Entrepreneur Spartacus Olsson und Marketingexperte Jan Schlüter, der als einer der ersten in Deutschland damit begonnen hatte, YouTube-Inhalte gezielt an Werbekunden zu vermarkten. Es war eine Mischung aus Unternehmern, Künstlern und Medienprofis, die gemeinsam einen völlig neuen Typus von Medienunternehmen schuf.
Auf dem amerikanischen Markt hatten sich bereits Allianzen von Künstlern, Vermarktern und Medienunternehmern gebildet. Machinima, Maker Studios, Awesomeness TV hießen die Vorbilder von Mediakraft, Divimove oder TubeOne in Deutschland. Die gegenseitige Unterstützung der Künstler, die bis dahin auf privater und informeller Ebene stattgefunden hatte, wurde weiter institutionalisiert.
Nun wurden Kanäle gezielt „optimiert“. Durch die Analyse von Hunderten von Kanälen waren die Netzwerke schnell in der Lage, die Faktoren zu identifizieren, die für erfolgreiche Inhalte ausschlaggebend waren. Dazu gehörten z. B. feste Upload-Tage oder aussagekräftige Vorschaubilder (Thumbnails). Mechaniken wie das Liken von Videos oder die Kommentarfunktion wurden strategisch eingesetzt, um die Reichweite einzelner Videos oder ganzer Kanäle zu vergrößern.
Andere Unternehmen folgten dem Vorbild von Mediakraft: In Berlin entstand das europaweit agierende Netzwerk Divimove (Digital Video Movement), in Hamburg der Vermarkter TubeOne. In München baute ProSiebenSat1 unter dem Namen Studio71 eine Abteilung auf, die gezielt auf Social-Media-Stars zuging und sie mit dem Versprechen lockte, von da den Sprung ins Fernsehen zu schaffen. Das Entertainment-Haus Endemol startete mit dem Venture „Beyond“ ins Abenteuer YouTube und baute mit Finanzierung von Google sogenannte Original Channels auf. Mit der „Original Programming Initiative“ wollte Google von 2012 bis 2014 weltweit professionelle Produzenten anlocken. Das Projekt wurde, wie viele andere Original-Channels auch, später eingestellt. Inzwischen hat Google alle eigenen Verweise auf die „Original Programming Initiative“ entfernt (Tubefilter, 2013).
Das Missverständnis der Netzwerke
Nach den ersten Erfolgen bekamen die Netzwerke allerdings eine Reihe von Problemen, die sie letztlich dazu zwangen, ihr Geschäftsmodell zu ändern. Ein grundlegendes Missverständnis bei den Netzwerken war dabei der Begriff an sich. Im anglo-amerikanischen Raum bezeichnet man mit „Network“ eine Sendergruppe im Fernsehen. Die Multi-Channel-Networks waren also TV-Stationen, die aus vielen einzelnen Kanälen bestanden und ausschließlich online sendeten. In den USA bestand nie ein Zweifel daran, dass es bei Netzwerken hauptsächlich darum ging, Inhalte zu erstellen, zu verbreiten und gewinnbringend zu vermarkten. Im Deutschen wäre darum die Bezeichnung „Online-TV-Sender“ oder ein Wortungetüm wie „Multikanal-Fernsehsender“ treffender gewesen.
Doch je mehr Netzwerke wuchsen und desto mehr Kanäle sie unter Vertrag nahmen, desto weniger konnten sie die in sie gesetzten Ansprüche erfüllen. Und eigentlich wollten sie das auch gar nicht. YouTuber auf diese Art und Weise rund um die Uhr zu betreuen, war schlicht unwirtschaftlich. Zwangsläufig, und einer dem klassischen Fernsehen nicht unähnlichen Produktionslogik folgend, begannen die Netzwerke damit, aussichtsreiche und werbefreundliche Kanäle mehr und besser zu unterstützen. Die finanziellen und personellen Aufwendungen für kleinere oder weniger ambitionierte Videomacher wurden hingegen zurückgefahren oder die Verbindungen gleich ganz gekappt, um die Größenordnung wieder in einen Bereich zu bringen, der einfacher zu managen war (Tubefilter, 2017).
Die Kritik am Geschäftsmodell der Netzwerke war schon immer da gewesen. Die meisten hatten versucht, einzelne Creator und deren Reichweite mit exklusiven, mit Laufzeiten versehenen Verträgen an sich zu binden. In diesem Zuge wurden den Creatorn immer bessere, lukrativere Deals angeboten. Steckte man aber bereits in einem Vertrag mit einem Netzwerk, konnte man diese Angebote nicht so einfach annehmen. Zum großen Knall kam es im Dezember 2014, als der damals erfolgreichste YouTuber Simon Unge ein Video veröffentlichte, in dem er sein Netzwerk Mediakraft scharf angriff. Unter dem Hashtag #freiheit solidarisierten sich dutzende Creator mit Unge. Mediakraft sah sich einem gewaltigen Shitstorm ausgesetzt, den das Unternehmen letztlich nicht überleben sollte (Der Spiegel, 2014). Es war klar, dass das bisherige Modell so nicht funktionieren würde. Die Creator wollten mehr Flexibilität und bessere Services.
Als der Markt rasant wuchs, zeigte sich, dass dieses Geschäftsmodell nur schwer skalierbar ist. Jim Louderback ist ehemaliger CEO der VidCon, der größten Creator-Veranstaltung in den USA. Auf die Frage, ob MCNs zurückkommen könnten, schrieb er in seinem Newsletter im November 2024:
„The answer is always no. If you think it’s hard to build a creator business on rented land, building a creator network on rented land is near impossible. Build a big enough network and the platforms become incented (Sic!) to see you fail. There are other collaborative creator models that might succeed – but even today’s „MCN“ companies have realized they need to pivot to services and SAAS – or to old-school management agencies – to be successful. “ (Louderback, 2024).
Leseprobe Ende
Im weiteren Verlauf lest ihr, wie aus der YouTube-Ära das Influencer Marketing entstand und welche Rolle Instagram dabei spielte. Im dritten Abschnitt geht es um die Evolution zur Creator Economy, bei der TikTok eine wesentliche Rolle spielte. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick auf die kommenden Herausforderungen für die Creator-Branche.
Wer das Kapitel oder das gesamte Buch lesen möchte, bekommt auf der Seite von Springer Gabler alles, was nötig ist.


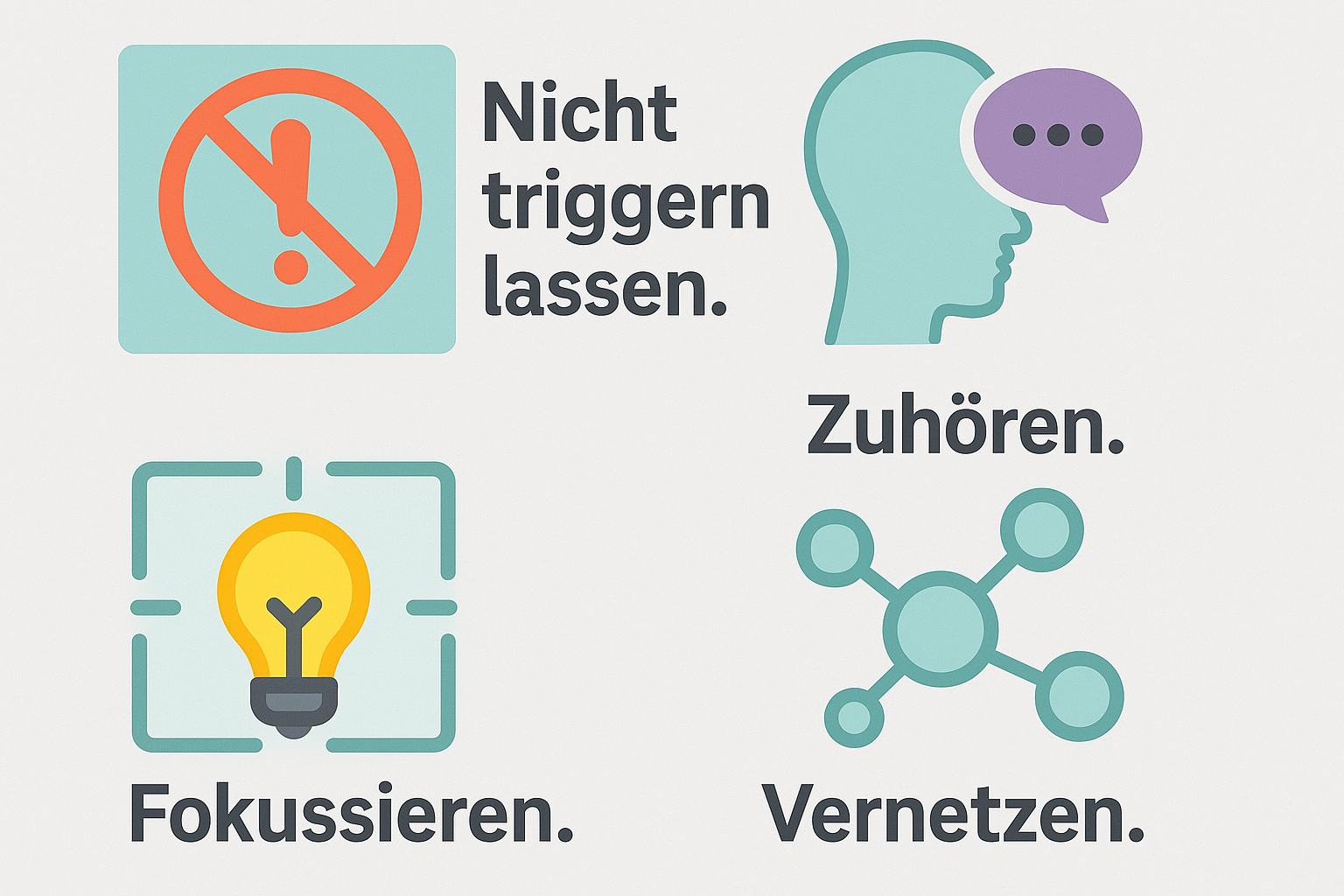
Hinterlasse einen Kommentar